Deutsche Märchen seit Grimm - gesammelt von Paul Zaunert
Eine liebevoll zusammengestellte Sammlung deutscher Märchen!
Paul Zaunert (* 20. Oktober 1879 in Bielefeld; † 24. Februar 1959 in Kassel-Wilhelmshöhe) war ein deutscher Sagenforscher.
Der promovierte Philologe war seit 1922 Mitherausgeber der Reihe Märchen der Weltliteratur und gab seit 1925 die Reihe Deutsche Volkheit heraus.
Aus dem Inhalt von Deutsche Märchen seit Grimm
Vorwort
Der vorliegende fünfte Bund unserer Märchen der Weltliteratur faßt zusammen, was an deutschen Volksmärchen noch nach der Sammlung der Brüder Grimm zutage trat; er ist als eine Ergänzung zu den Kinder- und Hausmärchen gedacht.
Den Grundstock zu den letzteren hatten Hessen und Westfalen geliefert, während große Teile Deutschlands entweder überhaupt nicht, ober nur spärlich darin vertreten sind; das Beispiel der Brüder Grimm gab dann den Anstoß zur Aufzeichnung von Volksmärchen in allen deutschen Landschaften, und die Literatur auf diesem Gebiete schwoll bei uns von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer mächtiger an.
Daß der Sammeleifer eines Jahrhunderts noch manches Wertvolle ans Licht gebracht hatte, war zu erwarten, und es war schon jahrelang ein Lieblingsplan von mir, einmal alle die deutschen Märchen zu sammeln, die sich bei den Brüdern Grimm noch nicht finden.
Doch ich war erstaunt über den ungeahnten Reichtum, der sich mir beim Durchwandern der deutschen Märchenliteratur nach und nach auftat; und die sich oft wiederholende Freude über ein neues Kleinod, das zwischen bekannten oder verworrenen und verblaßten Überlieferungen aufleuchtete, lohnte der Mühe, welche daS Sichten des überreichen Materials bereitete.
Grimms Märchen, an die sich dieser Band unmittelbar anschließt, waren auch für die Anlage meiner Sammlung vorbildlich.
Die neuere Märchenforfchung verfuhr ja vielfach anders, sie zeichnete jedes Märchen auf, so wie sie es vorfand, mit allen Zufälligkeiten der Überlieferung; Material für die wissenschaftliche Untersuchung zu gewinnen, war eben für sie der leitende Gesichtspunkt; in dem der Forschung gewidmeten Teil Ihres Märchenwerkes, dem 3. Band der Originalausgabe, haben es die Brüder Grimm ja in vielen Fällen auch schon so gemacht.
Festhalten des einzelnen Märchens, wie es aus dem Volksmunde kommt, mit sozusagen phonographischer Treue, das wäre in der Tat alles, was der Sammler zu leisten hätte, wenn das Märchen nur ein Objekt der Wissenschaft wäre, und wenn es wirklich vom Volke als Gesamtheit, von der Masse geschaffen wäre, etwa wie die Korallenstöcke von den Korallenpolypen.
Aber wir erkennen ja heute das Märchen als einen wesentlich komplizierteren Organismus, als Erzeugnis einer entwickelten Erzählungskunst, wie sie dem Volk als Masse nicht eigen sein kann, es setzt einen begabten Einzelnen als Schöpfer voraus, der es aus den im Volke umlaufenden märchenhaften Elementen gestaltete, im Geist des Volkes, und dem Geschmack dieses seines Publikums angepaßt.
Und das Volk hat nur diese vom Einzelnen geschaffene Urform übernommen und weitergegeben, nach seinem Sinn umgemodelt und abgeschliffen und ausgestattet, aber oft auch die Motive durcheinandergebracht und die Komposition mißverstanden.
Wieviel verkümmerte und entstellte, dürftig erzählte Fassungen begegnen dem Märchenforfcher.
Auch zum richtigen Auffassen und Behalten und anschaulichem Wiedererzählen gehört ja schon eine über den Durchschnitt hinausgehende Begabung.
Für eine Sammlung wie die gegenwärtige, die nicht nur dem Forscher ermöglichen will, daS deutsche Märchengut bequemer zu überblicken, sondern die in der Sachliteratur verstreuten Schätze wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zuführen soll, alle, große wie kleine Leute zu erfreuen und sie aus dem Alltag in eine Welt der Sonntagskinder, der fröhlichen Dummheit, der bunten und tiefen Träume zu versetzen, in der die Phantasie zu ihrem Recht kommt — für diese Sammlung war ein Weg geboten, ähnlich dem, welchen die Brüder Grimm wählten.
Wo mehrere Fassungen eines Märchens sich ergänzten, wurde die Möglichkeit, daraus eine vollständigere, geschlossenere, charakteristischere Erzählung zu bilden, benutzt; aber nur dann, wenn es ohne einen Eingriff in das innere Gefüge des Märchens ging, und ohne irgendwo, auch nur in kleinen Zügen, den Boden der volkstümlichen Überlieferung zu verlassen.
Selbstverständlich konnte auch sehr vieles unverändert übernommen werden, manches vortrefflich Erzählte fand sich, und daneben abgehackt, kümmerlich und nachlässig Wiedergegebenes, das einer Überarbeitung bedurfte.
Störendes Buchdeutsch und poetisierende Blümeleien und Sentimentalitäten, die der Sprache des Märchens fremd sind, wurden beseitigt.
Es kann hier nicht aber die Herkunft eines jeden Märchens, und, wo mehrere in eins zusammenflossen, über die verschiedenen Versionen, aus denen es entstand, Anschluß gegeben werben; das wird in einem besonderen Bande am Schluß der ganzen Serie geschehen; dort werden auch die wichtigsten Varianten mitgeteilt, sowie Nachweise für die Geschichte der einzelnen Märchen und ihre Verwandtschaft mit denen anderer Völker gegeben.
Nur einige allgemeine Bemerkungen über die Quellen mögen hier Platz finden.
Wie die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, so stammen in der Regel auch die nachfolgenden Sammlungen ihrer Hauptmasse nach auS einem bestimmten Teile Deutschlands, nicht aus dem ganzen deutschen Sprachgebiet, und man darf sich durch allgemeinere Titel nicht irreführen lassen.
Wolfs „Deutsche Hausmärchen“ z.B. wurden meist im Großherzogtum Hessen-Darmstadt gesammelt, Pröhles „Kinder- und Volksmärchen“ am Harz, Golshorns „Märchen und Sagen“ sind aus dem Hannöverschen, die „Kinder- und Hausmärchen aus Süddeutschland“, welche die Brüder Zingerle herausgaben, wurden in Tirol erzählt.
Wenn nun auch das Märchen sich ja nicht an einen bestimmten Ort bindet, und dieselben Märchen oft gerade in ganz entgegengesetzten Ecken des deutschen Sprachgebiets, etwa in Pommern und Siebenbürgen, auftreten, so sind doch Landschaft und Volksstamm nicht ohne Einfluß auf den Charakter einer Sammlung.
Jn der Schweiz werben mehr Geschichten von Hirten, an der Wasserkante mehr von Seefahrern und Fischern erzählt.
Das weitgewanderte Märchen von den drei Lebenslehren findet sich z.B. gerade in Friesland und dann wieder in Sommern.
Den pommerschen Märchen, die Ulrich Jahn gesammelt — hat nebenbei bemerkt eine der schönsten und wichtigsten neueren Sammlungen — merkt man es an, daß sie teilweise von Tagelöhnern erzählt wurden, die z. B. auf den Gutsherrn schlecht zu sprechen sind.
Wenn also auch der Kern der Handlung unverändert bleibt, so kann man doch die Einwirkung von Umwelt, Beruf und sozialer Stellung des Erzählers in der Bevorzugung dieser und jener Stoffe und in der Ausführung wahrnehmen.
Märchen aus allen deutschen Landschaften finden sich in diesem Bande zufammen und find zum Teil ja auch schon an einer mehr oder minder mundartlichen Färbung zu erkennen.
Bei den Sammlungen aus den deutschen Grenzgebieten war in manchen fällen Zurückhaltung geboten, weil sich dort die deutsche Überlieferung vielfach mit fremden, slawischen und andern, Elementen durchsetzt zeigte; manches dorthin zugewanderte Märchen wird fich reiner und charakteristischer in den spateren Bänden bei den Märchen anderer Völker finden; so gehört z.B. das Märchen von den drei Pomeranzen, bei Zingerle, nach Südeuropa.
Einzelne Ausnahmen konnten aber doch gemacht werden, das liebliche Märchen von den „Goldkindern“ z.B. haben wohl die siebenbürgischen Deutschen aus dem Walachischen übernommen, aber so schön aufgefaßt und wiedererzählt, daß es schade gewesen wäre, wenn es hier fehlte.
Entbehrlich waren dagegen für die Zwecke dieser Sammlung mehrere Erzählungen die uns bei Musäus wieder begegnen, da dieser ja selbst in den „Märchen der Weltliteratur“ erscheinen wird.
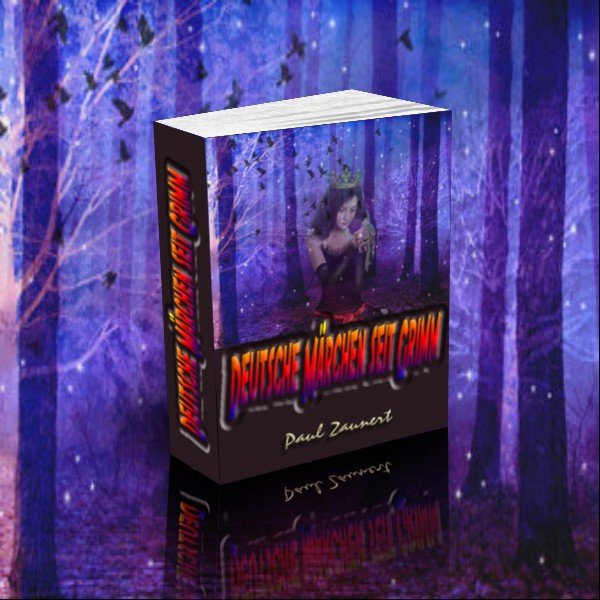
Bild: Deutsche Märchen seit Grimm
Viele Sammlungen führen sodann eine mehr ober minder große Zahl von Schwänken, Sagen und Legenden mit; das erzählende Volk scheidet ja zwischen dem Märchen und den genannten Gattungen nicht so, wie es die sichtende Forschung für ihre Zwecke tun muß; und im konkreten Fall sind die Grenzen tatsächlich oft fließend; so habe ich auch manche, nicht zu den eigentlichen Zauber- und Wundergeschichten gehörende Erzählung mit aufgenommen, in der sich Märchenthemata weiterspinnen.
Jn den schwankhaften Stücken handelt eS sich z.B. oft um nur vermeintliche oder vorgebliche Wunder, Hexereien und Wunschdinge.
Man könnte dergleichen rationalistische Umbildungen alter Märchenmotive für Erfindungen einer neueren aufgeklärteren Zeit halten, in denen das Märchenhafte fich allmählich verflüchtigt.
Aber die Streiche des „Vaters Strohwisch“ finden wir z.B. bereits zusammen mit denen des Grimmschen „Bürle“, in einem lateinischen Gedicht des 11. Jahrhunderts, dem „Unibos“; und unsere Erzählung gibt dann doch wieder diesem schwankartigen Stoff einen ganz echt märchenhaften Anfang und Schluß.
So spielen Fopperei, Täuschung und wirklich Wunderbares in diesen Übergangsformen zwischen Märchen und Schwank durcheinander.
Bei dem oft proteusartigen Wesen des Märchens, dem Hinübergleiten der Motive aus einer Erzählung in die andere, ist es natürlich, daß sich in diesem Bande auch Anklänge an Grimmsche Märchen finden, mannigfache Verwandtschaft in den Motiven und deren Komposition zeigen diese ja auch unter sich und mit den außerdeutschen Märchen.
Die Unerschöpflichkeit des Märchens besteht ja weniger in der Einführung immer neuer Motive, als in deren Umformung, Entfaltung, ihrer Verbindung zu neuen Einheiten.
Das Märchen hat etwas von der unvergänglichen Lebenskraft der Natur, die aus dem alten Boden immer wieder frische Gebilde hervortreibt; ein echtes Märchen, mag man noch so viel alte und weitherkommende Motive darin entdecken, ist immer neu, jung und „herrlich wie am ersten Tag“.
Eine ganze Reihe weit umhergewanderter, zum Teil fehr alter Märchen begegnen uns hier in eigenartiger deutscher Fassung; so das vom Meisterdieb („Die russische Finetee und die russische Galethee“), das nicht mit dem gleichnamigen Grimmschen zu verwechseln ist und das Herodot schon aus dem alten Ägypten kannte, ferner das Simsonsmärchen von der treulosen Frau oder Mutter des Helden, die das Geheimnis seiner Stärke verrät („Das blaue Band“), das Danaemärchen („Der lustige Ferdinand“ und „Vom Königssohn, der fliegen gelernt hatte“), die Geschichte vom büßenden und erlösten Räuber Maday („Räuber Höydl“), die beiden Versionen vom dankbaren Toten, die „Drei Lehren“ und so fort.
Überblickt man nun die bunte, vielgestaltige Menge der Märchen, die uns Deutschland außer den Grimmschen noch darbot so wird man, besonders wenn man die zahlreichen Varianten noch mit ins Auge faßt, bald darunter mehrere Lieblingstypen gewahr, auf die unser Volk immer wieder zurückkommt und an denen es seine Gestaltungskraff beweist.
Eine eingehende Charakteristik kann hier nicht gegeben werben, ich will nur auf ein paar besonbers leicht erkennbare Familienähnlichkeiten hinweisen.
Fabelbafte,kolossale, sozusagen absolute Dummheit z.B. ist von altersher bei allen Völkern ein dankbares, viel variiertes Märchenschema, auch die hier mitgeteilten Märchen enthalten wieder Beispiele davon.
Daneben aber findet sich bei uns in noch weit größerem Umfang eine besondere Art des Dummen.
Diefer dumme Hans, Michel, Krischan oder Peter ist mehr als ein bloßer Tölpel, er gilt nur in den Augen seiner Umgebung als ein solcher; „er war vielleicht gar nicht so dumm“, sagt ein österreichisches Märchen; „aber was er angriff, war seinen Brüdern zu schlecht, und so machte er halt gar nichts“, und saß hinter dem Ofen, und niemand, auch er selbst nicht, wußte, was in ihm steckte, bis seine Zeit kam und er durch seine reine, gläubige Einfalt und Geradheit, sein naives Draufgängertum, das keine Furcht kennt, durch feine Beharrlichkeit und Treue und durch sein mitleidiges Herz jene Taten vollbringt, die allen andern Sterblichen unmöglich sind.
Dabei wirb bald der eine, bald der andere Zug mehr hervorgekehrt; bald die Riesenstärke ober die Unerschrockenheit, bald mehr die Gutherzigkeit, bald mehr das Täppische, Schwerfällige, er muß etwa erst eine Tracht Prügel weg haben, bis er warm wird und seine Bärenkraft in Aktion tritt; überhaupt verträgt er ein gut Teil Lächerlichkeit, die bisweilen ins Groteske getrieben wird; andererseits fehlt ihm gegebenenfalls auch ein listiger Kniff ober Bluff nicht, er trifft instinktiv das Richtige.
An die Stelle dieses Helden, der ein Dümmling gescholten wird, weil er zu gewöhnlicher bäuerlicher und bürgerlicher Hantierung nicht taugt ober auch langmütig und geduldig sich die Rolle des Prügelknaben gefallen läßt, tritt dann in unseren Märchen auch wohl der junge Taugenichts, in dem aber ein guter Kern ist, oder ein desertierender Soldat, oder einfach ein armer, elternloser Bursch, der nichts geerbt hat als ein Schwert, oder gar nur ein Hirsekorn; kurz am liebsten aus einer verachteten, unscheinbaren Hülle läßt das Märchen den Helden hervortreten.
Zahlreich find ferner jene Märchen, in denen es sich um die Erlösung eines Menschen handelt, der in ein Tier verwünscht ist; ein Motiv, das wohl schon in vorgermanische Zeit zurückreicht.
Unser Märchen verbindet damit gern eine oft wundersam poetische Erzählung von der Treue und Opferfähigkeit der Frau, die den Geliebten durch irgendein Verschulden verliert und durch eine lange mühselige Wanderung wieder gewinnt; umgekehrt ist es auch oft der Mann dem die bereits erlöste oder durch Staub des Schwanengewandes oder sonstwie errungene Jungfrau wieder entschwindet, weil er ein Verbot übertreten, eine Bedingung außer acht gelassen hat, und der nun die Probe des ausharrenden Suchens bis in eine andere Welt hinein bestehen muß, oder der treue Bruder, der die verzauberte und entrückte Schwester erlöst, wie im letzten Märchen dieses Bandes, einem merkwürdigen Gegenstück der bekannten „Sieben Raben“.
Das Motiv von der treuen Frau, die dem Gatten nachpilgert, erscheint dann auch oft selbständig, ohne das vom Tierbräutigam, so in der bei uns ungemein beliebten romantischen Erzählung von der Prinzessin als Harfner, und wieder anders in dem schlicht schönen Märchen von „Siebenschön“, in dem eine heimliche Melodie ist wie von einem alten Volksliede.
Mit beiden Füßen in der deutschen Kinderstube sind wir dann, wenn unser Märchen mit freundlich ehrbarer Miene, aber nicht ohne ein heimliches Lächeln, den pädagogischen Singer erhebt und von jenen bald komischen, bald feierlichen Gestalten erzählt, die ähnliche Sanktionen haben, wie der Knecht Ruprecht: die artigen gutherzigen Kinder belohnen, die bösen bestrafen, oder wenn sie nicht grundschlecht, sondern bloß eigensinnig waren, sie in heilsame Zucht nehmen („Waldminchen“), sich hilfloser unschuldiger kleiner Seelchen annehmen („Die drei Fragen des Teufels“, „Die Goldkinder“), sie über verlorene Eltern und verlorene Pantöffelchen gleichermaßen zu trösten wissen und sie geradewegs in das unerhörteste Märchenglück hineinstapfen lassen („Von dem Breikessel“); einmal ist es ein graues Männlein, das diese Geschäfte besorgt, das andere Mal das Völklein der Unterirdischen, dann eine Waldfrau in großer Gala, dann wieder ein unscheinbares verhutzeltes Mütterchen, das nächste Mal unsere liebe Frau oder ein geheimnisvoller Bettelgreis, oder endlich der liebe Gott in Person.
Nie aber wird das Märchen zur langweiligen moralischen Erzählung; meiner primitiven, naturnahen Zeit entstanden, sinnt und spricht es ganz in der Auffassungs- und Ausdrucksweise des naturnächsten Wesens in unserer Zeit, des Kindes.
Damit ist nicht gesagt, daß alle deutschen Märchen, und so auch in diesem Bande, Kindermärchen sind; unser Märchen ist immer kindlich, aber nicht immer schon für Kinder.
Und so ist auch dies Buch nicht als Kinderbuch gemeint und soll nicht als Ganzes einfach den Kindern in die Hände gegeben werden.
Es ist für die Großen, die Eltern bestimmt, die sollen den Kindern daraus erzählen.
Denn erzählt müssen Märchen werden, nicht gelesen, gerade wie Volkslieder gesungen werden müssen.
Und so mögen diese Märchen, nachdem sie jahrzehntelang in ihren alten Büchern geschlafen haben, aus diesem Buch wieder ins deutsche Land hinausziehen, so frisch und rotwangig und wanderlustig, wie sie waren, als Großmutter noch jung war.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Prinzessin auf dem Baum
- Vom Mann ohne Herz
- Die Zwergmännchen
- Der lustige Ferdinand oder der Goldhirsch
- Das Posthorn
- Das Kätzchen und die Stricknadeln
- Das goldene Schloß
- Hans Wunderlich
- Vom dummen Peter
- Des vom Fräche, des uff die Hochzeit iß gänge
- Dree to Bett
- Papst Ochse
- Es ist schon gut
- Der fleißige und der faule Fischer
- Die beiden Fleischhauer in der Hölle
- Der Grafensohn
- Der Schneider und der Schatz
- Der faule Hans
- Die verstorbene Gerechtigkeit
- Goldig Betheli und Harzebabi
- Der eiserne Kasten
- Die Heckentür
- Ei so beiß!
- Vom glücklichen Schuster
- Von dem Breikessel
- Von den achtzehn Soldaten
- Die schöne Königstochter im Garten
- Das Kind mit dem goldenen Apfel
- Ode und de Slang'
- Die Wasserlisse
- ie der Bauer ein Doktor ward
- Den Seinen gibt's Gott im Schlaf
- Der Däumling und der Menschenfresser
- Wie die Ziegen nach Hessen gekommen sind
- Der Jäger und die Schwanenjungfrau
- Die beiden Goldkinder
- Großmütterchen Immergrün
- Siebenschön
- Die diebische Spinnstube
- Wie der Teufel das Geigenspiel lernte
- Der Königssohn und die Teufelstochter
- Die Schlange
- Die alte Kittelkittelkarre
- Das Hirsekorn
- Vom dicken fetten Pfannekuchen
- Die Springwurzel
- Rinroth
- Vater Strohwisch
- Wie der dumme die Prinzessin erlöst
- Der Soldat und die schwarze Prinzessin
- Die fünf Handwerksburschen auf Reisen
- Die Rübe im Schwarzwalde
- Der Ratsherr und das Bübele
- Der Schäferssohn und die zauberische Königstochter
- Die drei Träume
- Strom selig
- Schulze Hoppe
- Der dumme Wolf
- Die Geschichte von der Metzelsuppe
- Die Seidenspinnerin
- Die russische Finetee und die russische Galethee
- Der Stieglitz
- Waldminchen
- Räuber Hoydl
- Die verwünschte Prinzessin
- Des Toten Dank
- Das blaue Band
- Die drei Fragen des Teufels
- Der schnelle Soldat
- Die seltsame Heirat
- Warum das Meerwasser salzig ist
- Der Ritt auf dem Glasberg
- Das Leben am seidenen Faden
- Der Zaubertopf und die Zauberkugel
- Der Teufel als Müllergeselle
- Vom Königssohn, der fliegen gelernt hatte
- Die dummen Tierlein
- Das Borstenkind
- Der Büttel im Himmel
- Der Federkönig
- Der Zwergenberg
- Goldmariken und Goldfeder
- Die getreue Frau
- Stein-Eik un Steinböök
- 's Tüfels Erbsmues
- Dei verwünskede Isel
- Das Zauberroß
- Undank ist der Welt Lohn
- Die schönste Braut
- Das Schneiderlein und die drei Hunde
- Die Prinzessin von Tiefental
- Hahnchen und Hennchen
- Der Teufel und der Exekutor
- Der faule Karl
- Die schwarzen Männlein
- Die Krönlnatter
- Dreschfelgel und Feuerbrand
- Die eisernen Stiefel
- Drei gute Lebenslehren
- Böse werden
- Der Jude und das Vorlegeschloß
- Hund und Katze
- Bun 'n Mannl Sponnelang
- Das Rätsel
- Bruder und Schwester
"Deutsche Märchen seit Grimm" und tausende weitere Lese-Stücke für Sie zum online Lesen und Vorlesen im exklusiven Mitgliederbereich bei uns auf der einzigartigen "Märchen Welt XXL".
Wikipedia- und weitere Links zum Thema "Deutsche Märchen seit Grimm" und Paul Zaunert
Es gibt keine Wikipedia-Seite zu Deutsche Märchen seit Grimm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Zaunert https://www.lexikon-westfaelischer-autorinnen-und-autoren.de/autoren/zaunert-paul/ https://dewiki.de/Lexikon/Paul_Zaunert
